Wer sehen will, was Schauspiel heute kann, wer spüren will, welchen mitreißenden Sog eine Truppe entwickelt, die sich ihr spielerisches Können gegenseitig bis ins letzte Detail beweisen will, wer Lust hat, einen Abend zu erleben, der ganz und gar auf den Schultern seiner Darsteller ruht, der muss jetzt nach Wien fahren. Ans Burgtheater. Dort, wo die Besten der Besten ein Ensemble bilden. Lange hat man darauf gewartet, sie endlich einmal wieder auf einer Bühne zu sehen. Jetzt kann man es: Die Minichmayr. Die Peters. Den Maertens. Den Koch. Und genauso alle anderen, bislang vielleicht weniger bekannten: Die Hackl. Den Wächter. Die Matuschek. Die Rabl. Den Witzel. Die Augustin. Und den Strutzenberger. Oft sieht man an Theaterabenden ein oder zwei Schauspieler, die besonders gut sind, aber hier sind alle auf gleiche Weise hervorragend. Das ist fast schon unheimlich. Als wären sie Mitglieder einer einzigen großen Theaterfamilie.
Und in gewisser Weise sind sie das auch, an diesem Wiener Theaterabend, den der australische Star-Regisseur Simon Stone unter loser Motivübernahme von Henrik Ibsen mit dem Titel „Das Ferienhaus“ überschrieben hat. So idyllisch und harmlos das zunächst klingt, so düster und dramatisch wird es im Verlauf der drei Stunden werden. Stunden, die wir damit verbringen, eine Familie in ihrem zerstörerischen Untergrund kennenzulernen. Und dabei beobachten, wie sich die Vergehen der Vergangenheit in die Gegenwart übertragen, wie Verletzungen und Wunden über die Zeiten hinweg weiter schmerzen und neu aufgerissen werden.
Schreien und Flüstern
Die Familie – ein Grauen. Das Haus – ihr Schlachtfeld. Im Stil der klassischen Moderne gebaut, mit wandhohen gläsernen Schiebetüren steht es da, einladend und abschreckend zugleich, ein unschuldig wirkendes Ferienhaus, in dem sich die schlimmsten Dinge angetan werden. Das Haus bietet den überschaubaren Rahmen für die Familienaufstellung, sichert den erzählerischen Zusammenhang räumlich ab. Wie im gerade zu Recht so gefeierten Film „Sentimental Value“ von Joachim Trier, in dem ja auch ein Haus die heimliche Hauptperson ist, weil es die Geschichte einer Familie, ihr Schreien und Flüstern gespeichert hat. So ist es auch hier.
 Szenen keiner Ehe: Mutter und Sohn in „Das Ferienhaus“ in Stones InszenierungMarcella Ruiz Cruz
Szenen keiner Ehe: Mutter und Sohn in „Das Ferienhaus“ in Stones InszenierungMarcella Ruiz CruzGebaut hat das Haus Ende der Sechzigerjahre Onkel Karl – aber da fängt die Lebenslüge schon an. Denn eigentlich hatte sein Neffe die Idee dazu und Karl hat nur seinen Namen daruntergesetzt. So wie er sich auch sonst durchs Leben lügt und dabei auf schändliche Weise an denen vergreift, die ihn umgeben. „Ich bin ein Wrack“, klagt er im gefährlich hilflos wirkenden Idiom von Michael Maertens zu Beginn, aber in Wahrheit ist er es, der alle um ihn herum zu Wracks gemacht hat. Selbst vor der Tochter seines Bruders ist er nicht zurückgeschreckt, hat Hand an sie gelegt, sich an ihr vergangen. Jahre später kehrt sie in das Ferienhaus ihrer Kindheit zurück, als Alkoholsüchtige, als Streunende, toxisch torkelnd. Wie Birgit Minichmayr hier als Caroline auftritt, wie sie die Qual ihrer Erfahrung langsam ans Licht kommen lässt, das ist ein Ereignis, für das allein sich der Abend lohnt. In näselnd nervösem Tonfall begrüßt und verschreckt sie alle, führt ihnen als wandelnde Katastrophe vor, was hinter dem mühsam gerade gehaltenen Familiensegen an Grausamkeit steckt. Laut, bedrohlich, mit jener komödiantisch getarnten Aggressivität, mit der sie schon damals in Luc Bondys Inszenierung vom „König Lear“ als Narr auftrat. 2007 war das, vor fast zwanzig Jahren, und doch hat sich Minichmayr die strenge Eigenart ihres haltlosen Spiels bewahrt. Es ist, als ob ihr Körper ständig drohte irgendwo gegenzustoßen oder abzustürzen, als ob ihr Geist gerade kurz davor wäre, aufzugeben, aber dann fängt sie sich im letzten Augenblick noch. Und dieser Augenblick bestimmt ihr ganzes Spiel.
Ins Bewusstsein gehämmert
Das andere Wrack ist Karls eigener Sohn Sebastian, den er bei jeder Gelegenheit demütigt. Verzweifelt versucht der, der Familienhölle zu entkommen, indem er auf lauten Partys mit fremden Männern schläft. Aber auch er kehrt am Ende, unheilbar an HIV erkrankt, in das Haus seiner Kindheit zurück, um dort zu sterben. Von seiner Mutter verabschiedet er sich mit einer infernalischen Abrechnung. Nichts ist Vorwurf, so wie der grandiose Thiemo Strutzenberger hier spricht, alles ist hiobhafte Anklage. Die Seelenzerstörung, vor der die Mutter jahrelang die Augen verschlossen hat – jetzt hämmert er sie ihr gnadenlos ins Bewusstsein.
Es ist nicht die durch Zeitsprünge künstlich verkomplizierte Handlung, es sind nicht die mitunter seltsam aseptisch wirkenden Dialoge, denen der Abend seine Anziehung verdankt. Es ist das unbedingte Vertrauen in die Überzeugungskraft seiner Darsteller, das ihn auszeichnet und aufregend macht. Ebenso wie die von Lizzie Clachan aufwendig gebaute Bühne, die in realistischer Anmutung eines jener Häuser zeigt, die Steine durch Glas ersetzen und damit bereitwillig alle Innerlichkeit preisgeben. „Wollen Menschen wirklich in Terrarien leben?“, fragt Karl einmal lakonisch und ruft rhetorisch nach „mehr Gemütlichkeit“. Aber in Wahrheit ist dieses Haus schon lange kein objektiver Gegenstand mehr, sondern ein verstrahltes Gelände. Kurz nach ihrem sechzigsten Geburtstag lässt die missbrauchte Nichte es wieder aufbauen, als „Mahnmal ihres Überlebens“ und als Rückzugsort für Frauen, denen heute Ähnliches widerfährt. Aber als Bürgermeisterin und Stadtrat sich gegen ihren humanitären Aktivismus stellen, zündet sie das Haus kurzentschlossen an und schaut apokalypsefroh in die lodernden Flammen.
 Psychologische Spannbreite: Michael Maertens als Onkel KarlMarcella Ruiz Cruz
Psychologische Spannbreite: Michael Maertens als Onkel KarlMarcella Ruiz CruzFür einen Moment überkommt Simon Stones ansonsten realpräsentische Inszenierung ein mythischer Schauer, wird aus dem Ort der traumatischen Erinnerung ein Raum unverzeihlicher Sünde. Keine Vergebung, es hilft nur die gegenseitige Zerstörung, so lautet das Credo des Abends. Sowenig ihn die Dimension des Geheimnisvollen interessiert, so wenig kennt er die Kategorie der Seele. Von Ibsen sind hier nur die Konflikte, nicht die Fragen übernommen. Alles wird ausbuchstabiert und ausgespielt, überschrieben für eine Jetztzeit, deren psychologische Spannbreite sich im Wechselspiel von Stress und Bewältigung erschöpft.
Aber diese dramaturgische Direktheit nimmt man in Kauf, weil man im Gegenzug so vorzügliches Spiel zu sehen bekommt. Stone bietet mit seiner neuen Fassung eines ursprünglich schon 2017 in Amsterdam unter dem Titel „Ibsen huis“ auf die Bühne gebrachten Abends eine phänomenale Schauspielschau. Ein Theaterereignis, um das die deutschsprachige Bühnenprovinz die Wiener Bühnenhauptstadt nun wieder einmal von Herzen beneiden darf.

 vor 1 Tag
5
vor 1 Tag
5


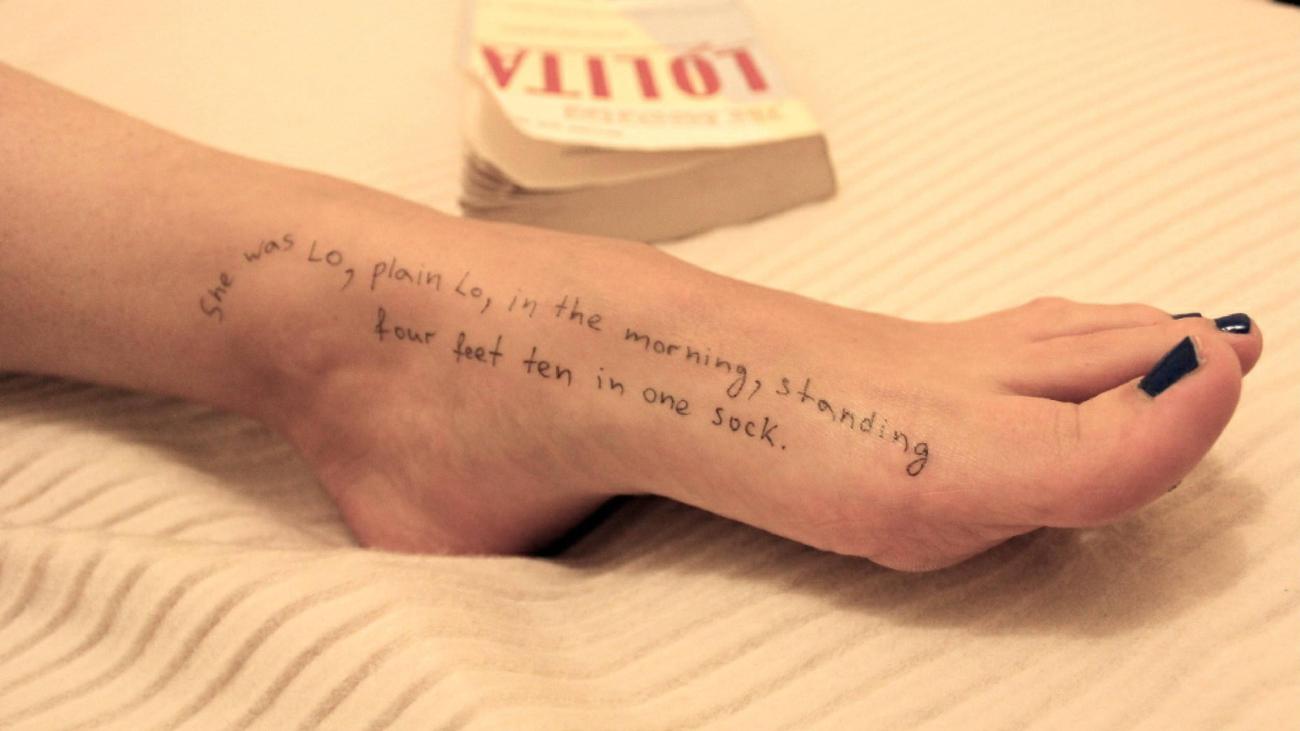







 English (US) ·
English (US) ·