Warum haben Alexander Puschkin oder Leonhart Wohlmut im 19. Jahrhundert, Peter Shaffer oder Miloš Forman im späten 20. Jahrhundert in höchst unterschiedlichen Dicht-, Bühnen- und Filmwerken Leben und Werk Wolfgang Amadé Mozarts thematisiert? Sie hatten Fragen. Beispielsweise die, wie sich die Ausnahmeerscheinung einer unfassbar hohen Begabung zur herrschenden Regel durchschnittlichen Bemühens verhält, anders gesagt, wie die Masse des Mittleren zum Einzelnen des Unerreichbaren steht. In unserer egalitären Zeit spielt das Genie scheinbar keine Rolle mehr, wogegen auffällt, dass kultische Verehrung von außergewöhnlichen Menschen Gang und Gäbe ist.
Mozart gehört offensichtlich noch zu diesen, irgendwie aber auch nicht mehr. Die ihm einst errichteten Denkmäler sind keine Wallfahrtsziele mehr, anders als das Memorial für Michael Jackson, zu dem in München die Gluck-Statue am Promenadeplatz umfunktioniert wurde. Doch im Klischee lebt Mozart als Kunstgott munter weiter. Schokoladenkugeln, eine Kleine Nachtmusik, schöne Frauen und ein bitterbös früh endendes Erdendasein bestimmen das Bild. Und ein Diadam, diadam, diada-a, das aus Mobiltelefonen nach Erlösung ruft.
Was die Vorstellungskraft an Zeitgeistigem hergiebt
Warum also Ende 2025, am Vorabend von Mozarts 270. Geburtstag, ein paar Millionen Euro gebührenfinanzierter Primetime dem fernen „Amadeus“ widmen? Wer soll erreicht werden, in welcher Absicht und zu welchem Ziel? Vor allem, welcher grundlegenden Idee könnte sich ein medialer Zugang zu Mozart im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts verpflichten? Im Vorspann zur ARD-Serie „Mozart/Mozart“ wird unmissverständlich klargestellt, dass es um die Geschichte der Geschwister Mozart gehe, also um Bruder und Schwester Maria Anna. Historische Überlieferung, der nachzuspüren langweilig gestrickte Geister vielleicht für geboten halten, wird aber zugunsten der „Vorstellungskraft“ konsequent zur Seite geschoben. Wie öde auch, Vergangenheit rekonstruieren zu wollen, wo doch jeder weiß, dass Geschichte nicht ist, sondern gemacht wird.

Im ersten Brainstorming zum Film werden die kreativen Köpfe um Regisseurin Clara Zoë My-Linh von Arnim sowie das Drehbuchgespann Andreas Gutzeit und Swantje Oppermann auf einen Zettel geschrieben haben, was ihre Vorstellungskraft an Zeitgeistigem hergab: Gendergerechtigkeit, Geschlechterfluidität, Postcolonialism, Patriarchat, Machtmissbrauch, Feminismus, Wokeness, um mal ein paar Stichwörter zu zitieren. Ach ja, und auch Musik, hier in der Abart der Klassik oder E-Musik.
Geschichte à la carte
Wer sich vom Anspruch freihält, das einst Gewesene wenigstens annäherungsweise darzustellen, verschafft sich freie Bahn für einen Plot, der gegenwärtiger Auffassung vom Genre des Biopics entspricht. Mit einem Anhauch von Bonnie und Clyde werden Szenarien milden Betrugs durchgespielt, was geht, weil Maria Anna ihrem alkohol- und drogenabhängigen, schließlich im harten Entzug weggeschlossenen Bruder Amadeus musikalisch ohnehin das Wasser reichen kann. Auch sonst wird mit dubiosen Karten gespielt. Salieri, von Beruf talentärmlicher Intrigant (irgendwie bekannt), waltet seines hinterhältigen Geschäfts, findet aber auch Eingang in Maria Annas willigen Schoß.
Kaiser Joseph scheint bereits ein wenig von habsburgischen Gendefekten beeinträchtigt zu sein, so durchsetzungsschwach, wie er ist (vielleicht liegt’s aber auch an der vegetarischen Kost, die er täglich löffelt). Seine in permanentem sexuellem Notstand agierende Schwester Marie-Antoinette, die vor ihrem angeblich zeugungsunfähigem Gatten Louis nach Wien entflohen ist, sucht nach Vergnügungen bei Tisch und in der Champagnerwanne, wenn sie nicht durch Mozarts (Maria Annas) Klavierspiel ausgelöste Unterleibswonnen genießt. Ihr laufe die Zeit weg, klagt sie, das Stichwort Menopause fällt also, wie sich’s in diesen Tagen gehört. Wer will da die Nase rümpfen, dass Mozart schließlich auf grüner Wiese den französischen Thronfolger zeugen darf. Leopold hatte einst mal was nicht folgenlos Gebliebenes mit einer fabelhaften dunkelhäutigen Sängerin, wozu er als charakterloser weißer Mann nicht stehen wollte.
Ratlos vor den Bildschirmen
All diese und weitere, in fernsehbildgerechter Üppigkeit auf imaginäres Ancien Régime getrimmten Phantasmen ließen sich hinnehmen, zumal sie mit den Mozarts nichts, aber auch gar nichts zu tun haben, hätte dieses Produkt vorstellungskräftigen Unvermögens nicht eine zentrale Leerstelle. Im fatalen Vakuum des Films steht ausgerechnet die Musik. Mozarts Kompositionen kommen lediglich in minimalen Ausschnitten oder kaum identifizierbaren Schnipseln vor, als seien von ihnen nur mehr unzusammenhängende Fragmente aus grauer Vorzeit erhalten. Stattdessen bieten Jessica de Rooij und Felix Raffel bunt gemixte Versatzstücke eines Allerwelts-Electro-Pops, dessen Ton- und Klangratatouille mit bestürzender Beliebigkeit daherkommt. Man spürt die Absicht, nämlich die suggestiv wirkende Kraft von Mozarts Musik mit zeitgenössischen Mitteln erzeugen zu wollen, und ist verstimmt, weil eben diese dafür viel zu schwach sind.
Das Publikum sitzt nach viereinhalb Stunden Sendezeit ratlos vor den Bildschirmen. Wer segnet solche Aufträge an Produktionsunternehmen ab, wer entscheidet über den Grenzverlauf zwischen legitimer Unterhaltung und angemessener Erfüllung des Bildungsauftrags? Warum bleiben Fachleute aus Kultur, Musik und Wissenschaft bei derartigen Vorhaben unbeteiligt? Da gute und schlechte Filme meist gleich viel kosten: Warum macht man nicht lieber gute? „Mozart/Mozart“ wirft Fragen auf, deren Brisanz ernst zunehmen wäre. Oder fehlt dafür die Vorstellungskraft?
Der Autor ist Professor emeritus an der Universität Würzburg und wurde für seine Untersuchungen zu Mozarts Schaffensweise mit der Mozartmedaille der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg ausgezeichnet.

 vor 2 Stunden
1
vor 2 Stunden
1


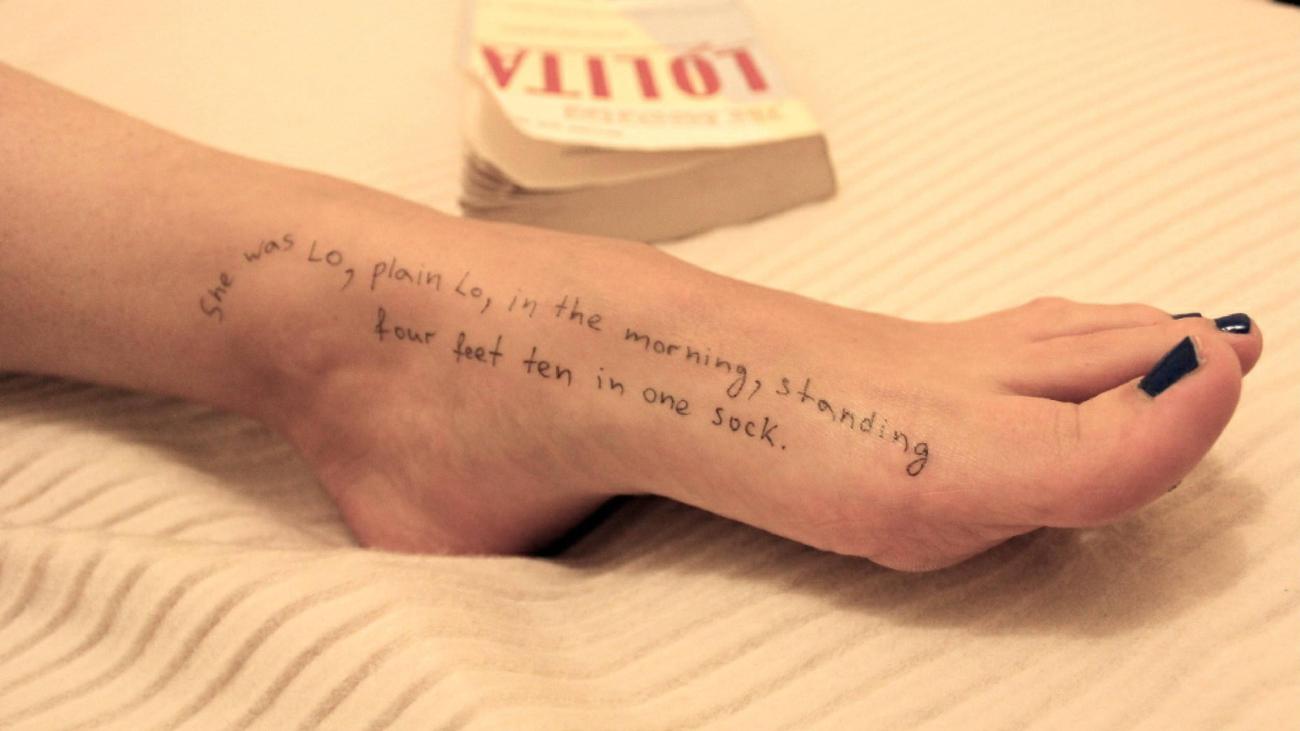
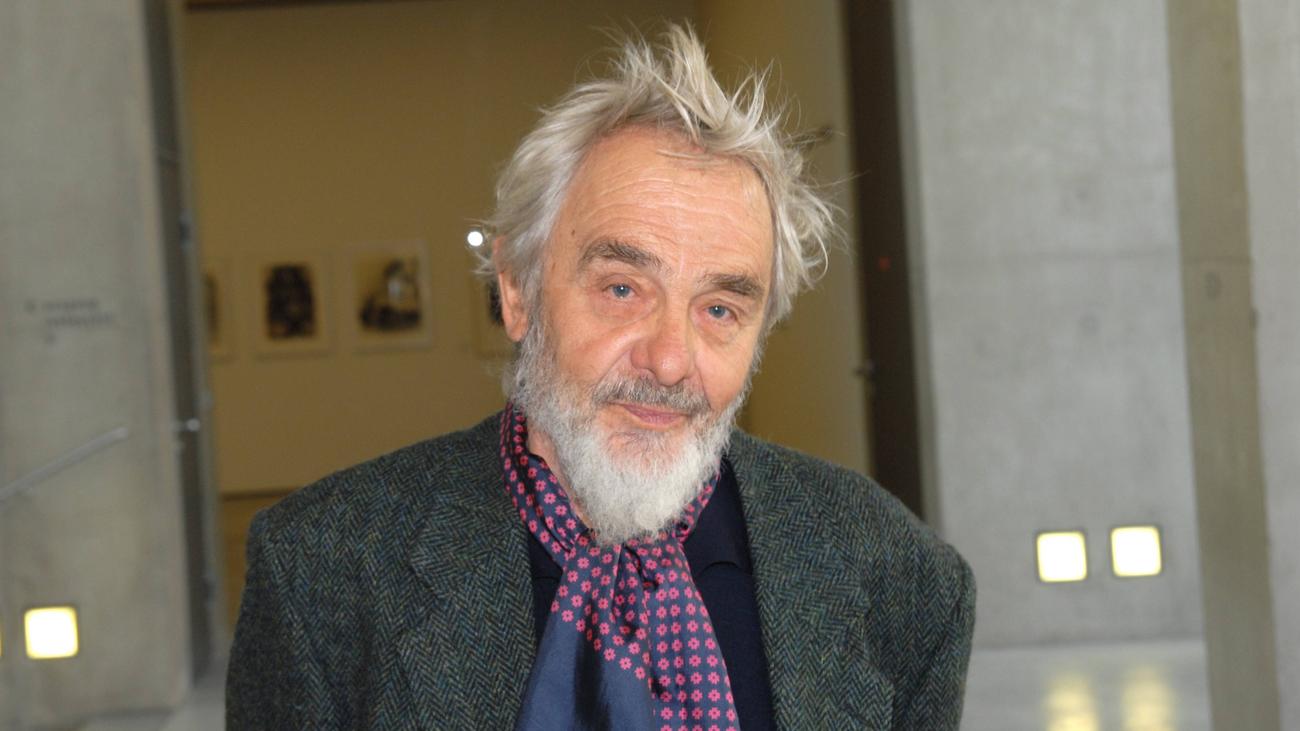






 English (US) ·
English (US) ·