Wer es bequem haben will, steuert Ellesmere Island im nördlichsten Kanada mit dem Kreuzfahrtschiff an, setzt dick vermummt einen Fuß aufs kalte Land und lässt sich die Sache mit dem Klimawandel, der Forschungsstation und den Eisbären erklären: was es jetzt noch gibt und bald vielleicht schon nicht mehr. Dann macht er schleunigst, dass er wieder wegkommt. Bei fünfzig Grad unter dem Gefrierpunkt halten es hier nur die Inuit und eine sehr überschaubare Zahl von Tieren aus: Polarfüchse, Wale, ein paar harte Seevögel.
Dieses Ellesmere Island war der Punkt, an dem im März 1990 ein siebenundzwanzigjähriger Norweger namens Erling Kagge und zwei etwa gleichaltrige Freunde aufbrachen, um auf Skiern den Nordpol zu erreichen – ohne Hunde, Versorgungsdepots und motorisierte Hilfsmittel. Das hatte bis dahin noch niemand geschafft. Jeder der jungen Männer zog einen Schlitten, der mit 120 Kilo Material und Proviant beladen war. Was man so braucht, wenn man bei eisigen Temperaturen länger unterwegs ist: Dörrfleisch, Haferflocken, Fett, Schokolade, Benzin für den Kocher und andere Kleinigkeiten. Nach zehn Tagen verletzt sich einer der Freunde und muss abgeholt werden. Erling Kagge und Børge Ousland ziehen allein weiter. Am Ende werden es 58 Tage für 770 Kilometer. Die Rechnung ist schief, denn die riesigen Eisschollen, auf denen sie laufen, treiben oft wieder südwärts, sodass ihre zurückgelegten Kilometer viel mehr gewesen sein dürften.
Die Weltkarte riecht nach nichts
„Mein Nordpol: Eine Biografie“ handelt immer wieder von dieser unglaublichen Reise, aber in wohldosierten, geradezu diskret geschriebenen Absätzen. Kagge will mit dem Abenteuer nicht angeben. Sein eigentliches Thema ist die Faszination der Menschen durch den Nordpol vom Anbeginn des Denkens. Der oberste Bibliothekar von Alexandria, Eratosthenes von Kyrene, setzte vor mehr als 2000 Jahren an die Stelle, die er sich als das nördliche Ende der Welt vorstellte, die Insel Thule. Die Kirchenväter wiederum mochten sich überhaupt keinen Ort vorstellen, der in der Bibel nicht erwähnt wird. Da hatte Ptolemäus längst erkannt, dass der Weg zur Erkenntnis „über die Mathematik und nicht über die Metaphysik führt“.
 Früher Morgen, langsames, aber stetiges Vorankommen über das Polarmeer: Foto aus „Mein Nordpol“Børge Ousland
Früher Morgen, langsames, aber stetiges Vorankommen über das Polarmeer: Foto aus „Mein Nordpol“Børge OuslandMit federnder Eleganz schreitet Kagge die Geschichte des menschlichen Nordpol-Wissens ab, das lange Zeit leer wie eine Eiswüste war, und landet im 16. Jahrhundert bei Mercators Weltkarte. Erst sie zeigt, dass der Nordpol an der Spitze des Erdballs liegt. Im Sommer 2022, mehr als dreißig Jahre nach seiner Tour, lässt Kagge sich von einem Bibliothekar in Basel die Blätter der Mercator-Karte im Original zeigen. Sie riechen nach gar nichts, kein Hauch aus dem fernen Jahr 1569. „Nach den langen Jahren im Archiv war die Karte ebenso geruchsfrei wie die Luft am Nordpol, wo alle Partikel zu Eis gefrieren.“
Eine Erkenntnis des 18. Jahrhunderts
Erling Kagge spricht von vier Erscheinungsformen, in denen wir den Nordpol begreifen: geographisch (auf der Landkarte), himmlisch (wenn man die Linie vom Südpol durch den Nordpol bis in die darüberliegende Atmosphäre verlängert), magnetisch (als Orientierung für die Seefahrt) und imaginär. Es ist diese letzte Form, die den Autor fesselt und seit den Tagen, als er mit sieben Jahren seinen ersten Globus bekam, nicht mehr losgelassen hat. Es ist der Nordpol in den Köpfen, der lange Zeit unwirkliche Ort, der Punkt, der die Menschen antreibt, die Grenzen des Vernünftigen weit hinauszuschieben. In gewisser Weise: hinaus in den Himmel.
 Erling Kagge: „Mein Nordpol. Eine Biografie.“ Aus dem Norwegischen von Ebba D. Drolshagen. Insel Verlag, 520 Seiten, 28 Euro.Insel Verlag
Erling Kagge: „Mein Nordpol. Eine Biografie.“ Aus dem Norwegischen von Ebba D. Drolshagen. Insel Verlag, 520 Seiten, 28 Euro.Insel VerlagDer größere Teil des geschmeidig übersetzten Buches handelt von den Versuchen, den Fuß genau auf den Punkt zu setzen, an dem alle Längengrade konvergieren. Das führt zu verlustreichen Abenteuern und tragischen Schicksalen, sorgt aber auch für einige der nachhallenden Heldensagen der Expeditionsgeschichte. Man probiert es mit dem Schiff, mit dem Ballon, auf Schlitten, auf Skiern. Und mit sehr vielen Hunden, von denen einige als Verpflegung dienen. Es dauert bis zum 18. Jahrhundert, dass es sich bei den Schiffsbauern herumspricht, ohne Rumpfverstärkung sei jedes Schiff chancenlos gegen die gewaltigen Naturkräfte des Eises. Trotzdem sind die Geschichten Legion, in denen eine Expedition unwiderruflich festsitzt und das Schiff verlassen muss – sei es, weil es von den Eismassen zerdrückt wird wie eine Nussschale, sei es, weil die Nahrungssuche die Besatzung nach draußen auf gigantische Eisschollen treibt.
Ein Archiv der Dummheit, Verblendung und Selbsttäuschung
Natürlich sind es Briten, die der Nordpol-Expedition im 18. Jahrhundert die wissenschaftliche Weihe geben. Constantine Phipps zieht aus, um in der Arktis Zoologie, Kartographie und Astronomie zu erforschen, und scheitert am Packeis. Englische Kinder kennen diese Expedition aber vor allem, weil der spätere Nationalheld Horatio Nelson als Fünfzehnjähriger zur Mannschaft gehörte. Seine Begegnung mit einem Eisbären ist im Lauf der Jahrzehnte zur legendentauglichen Großtat ausgeschmückt worden und verbreitete sich als Kupferstich unter dem Titel „Nelson and the Bear“ im ganzen Land. Es folgten weitere Entdecker-Abenteurer, darunter James Cook. Dann russische Expeditionen, die im Auftrag von Katharina der Großen riesige Areale in Sibirien und Alaska sicherten, immer im Namen der Forschung.
Kagges Nordpol-Erzählung lässt sich auch als Archiv der Dummheit, Verblendung und Selbsttäuschung lesen. Zahllose Expeditionen enden in der Katastrophe, weil die Protagonisten falsche Vorkehrungen treffen, die Naturkräfte unterschätzen oder den Rat erfahrener Arktisfahrer missachten. Der britische Polarforscher William Parry (1790 bis 1855) war so vernünftig, die Rentiere vor den eigens konstruierten Schlittenbooten vorher auszuprobieren – am Ende fuhr er ohne Rentiere und ohne Schlitten. Dafür hatte er die Gegenströmungen des Meeres nicht bedacht. In zwei Monaten kam er keine 300 Kilometer weit.
Das tragische Scheitern als neues Ideal
An dieser Stelle spricht Erling Kagge von der Ernährung während seiner eigenen Tour. Schon lange vor dem Start muss man den Körper daran gewöhnen, eine riesige Menge Fett aufzunehmen. Ohnehin magern die beiden Freunde im Lauf der Wochen dramatisch ab, ein kalkulierter Wettlauf mit der Zeit. Abgesehen von den Gefahren gibt es auch beglückende Momente, etwa die Geräusche des Eises, wenn es knarrt, kreischt, grummelt und ächzt – sofern sich nicht eine Wasserrinne öffnet und neue Gefahr heraufbeschwört. Einmal stürmt ein Eisbär auf sie zu, und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihn zu erschießen. Auf dieser Tour geht es um Leben und Tod.
Öfter verneigt der Erzähler sich vor den Polarforschern, die vor ihm kamen, auch wenn sie fehlbar waren: der obsessive Polfahrer Charles Francis Hall oder der Expeditionsleiter Adolphus Washington Greely, bei dessen Tour zahlreiche Menschen starben und die sechs Überlebenden nach den ersten Sensationsberichten mit Kannibalismus-Vorwürfen konfrontiert wurden. Wo es andere schaudert, wagt Kagge sich aufs moralische Glatteis und spricht vom „Notrecht“ in extremen Situationen. Ebenso klar benennt er den Medienhype, der um die Nordpol-Abenteuer besonders in Amerika und England entbrannte. Pressemogule wurden zu Sponsoren, die Auflagen schossen in die Höhe. Das neue Ideal des Extremsports Nordpoltour war das tragische Scheitern – doch dazu musste man wiederkommen und die heroische Niederlage bezeugen. Auf andere Weise tragisch war das Schicksal des Norwegers Roald Amundsen, der als Erster die Nordwestpassage durchfuhr und 1928 bei dem Versuch, einen italienischen Polarforscher zu retten, im Eis starb.
Der sinnstiftende Blick
Wenn es einen stillen Helden in diesem Buch gibt, dann Fridtjof Nansen. Der große, äußert fotogene Künstler und Zoologe vermittelte dem Autor dieses Buches die entscheidende Lehre: „Man muss mit den Kräften der Natur arbeiten, wer gegen sie kämpft, wird scheitern.“ Deshalb ging Nansen zu den Inuit, lernte ihre Sprache und übernahm ihre Überlebenstechniken. Er trug auch ihre Kleidung – genau wie Erling Kagge und Børge Ousland. Das beste Schuhwerk, so lernen wir, sind immer noch „Kamiks“, die von den Inuit getragenen Stiefel aus Robbenfell: knielang, bequem, fetthaltig, sehr warm, fast wasserdicht – und auch das sollten wir noch hören: „Auf dem Weg zum Nordpol haben wir unsere Unterwäsche sechsunddreißig Tage lang kein einziges Mal ausgezogen.“ Nicht so schlimm. Man riecht ja nichts. Und selbst wenn: Es ist niemand da, der sich beschweren könnte.
„Es muss etwas kosten, es muss mühevoll sein“, schreibt der Autor, und man glaubt es sofort, wenn man im Buch die eindrucksvollen Farbfotos sieht. „Kälte, Wind, Durst, steile Aufstiege. Die Befriedigung liegt darin, sich unter Anstrengung in die richtige Richtung zu bewegen.“ Im Lauf der Jahrzehnte hat Kagge erkannt, dass seine Kinderfaszination nicht dem Nordpol galt, „sondern dem Weg dorthin“. Dass es ihm nicht um Eroberung ging oder das Stillen einer Sehnsucht, sondern um Erkenntnis: „Je mehr ich über den Nordpol höre, lese und lerne, umso klarer wird mir, dass die Geschichte des Nordpols die Geschichte unseres Verhältnisses zur Natur ist – unserer sich verändernden Gefühle und unseres Respekts vor einer Umwelt, die nicht von Menschen geschaffen wurde.“
Erst der ganzheitliche Blick verleiht dem Abenteuer Sinn. Und erst die Entbehrungen lassen den Nordpol-Abenteurer begreifen, welch erhabene Landschaft durch die Erderwärmung vom Untergang bedroht ist. Eine Mahnung an uns alle, was sonst?

 vor 1 Tag
4
vor 1 Tag
4


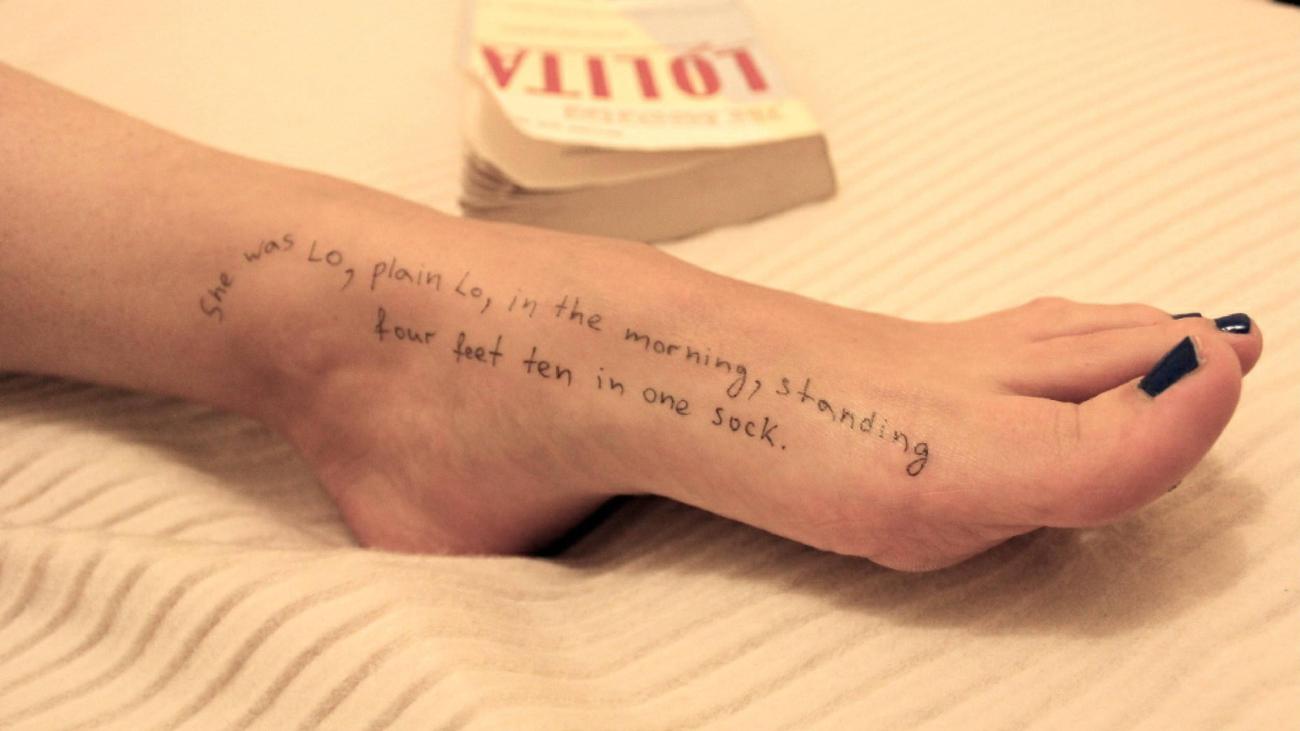







 English (US) ·
English (US) ·