Herr Mikkelsen, in der dänischen Tragikomödie „Therapie für Wikinger“ spielen Sie einen Mann, der sich für John Lennon hält. Wenn Sie selbst am Drehbuch mitgearbeitet hätten: Welcher von den vier Beatles hätte Ihnen am besten zugesagt?
Ringo Starr? Er ist noch am Leben und hat prächtige, schwarze Haare.
Der Regisseur Anders Thomas Jensen ist sehr erfolgreich mit Filmen, in denen er Männer in merkwürdige Vorgänge verwickelt. Häufig sind Sie in diesen Gruppen der Schrägste.
Zuletzt, in „Helden der Wahrscheinlichkeit“, war ich ausnahmsweise einmal der „Normalste“, aber insgesamt haben Sie recht: Jensen liebt es, mich immer wieder ins Extreme zu treiben, jetzt auch mit diesem verschreckten Mann namens Manfred alias John Lennon.
Das Kernthema in „Therapie für Wikinger“ ist ein ernstes: väterliche Gewalt in der Familie. Menschen werden für ein Leben gezeichnet, wenn sie als Kinder so etwas erleben. Muss man etwas von Traumatisierungen wissen, um davon erzählen zu können?
Kreativität hängt nicht von Trauma ab. Es ist aber wichtig, für mich als Schauspieler wie auch für den Regisseur, etwas über die menschliche Erfahrung zu wissen.
Zu Ihrem Image gehört es, dass Sie oft Schurken spielen. Nun ist es ein Mann, der sich nahezu vollständig in seine Phantasiewelten zurückgezogen hat. Er hält sich ja, so der Originaltitel des Films, für den „letzten Wikinger“. Steckt in dieser Imagination der Kern der Arbeit eines Schauspielers?
Ich spiele Manfred als das sechsjährige Kind, das er immer geblieben ist. Er hält sich im Hintergrund, weil er der Welt misstraut. Er ist aber auch sehr narzisstisch, wie das Kinder nun einmal sein können, sobald er auf die Bühne tritt und das Kommando übernimmt.

Sie haben erzählt, dass Sie in Kopenhagen in den Sechzigerjahren eine glückliche Kindheit hatten.
Über die Kindheit kann ich Geschichten erzählen, die weniger schön sind, und ganz tolle Sachen. Das ist wie mit dem halb vollen oder halb leeren Glas. Kindheit ist das, was man von ihr will.
Ich frage, weil man ja bei Schauspielern gern nach einem Schlüssel sucht: Von welchen Erfahrungen geht jemand aus, wenn eine ungewöhnliche Figur zu spielen ist? Ein Method Actor, der tief in der eigenen Psyche schürft, sind Sie ja eher nicht.
Ich neige dazu, Erinnerungen zu suchen, aber das hat nichts zu tun mit Method Acting. Das wird oft sehr missverstanden. Method Acting ist im Grunde eine langweilige Technik, mit der man ein Gefühl hervorrufen kann. Es hat nichts damit zu tun, wenn jemand für eine Rolle 100 Kilo zunimmt. Im konkreten Fall bei Manfred: Ich versuche zu verstehen, was ihn glücklich macht. Das kann auch etwas Banales sein. Ich muss es nur verstehen. Man kann es mit den Vorbereitungen auf eine Rolle auch übertreiben.
Robert De Niro gilt als ein Verfechter des Method Acting. Wie er den Travis Bickle in „Taxi Driver“ gespielt hat, hat Sie sehr beeindruckt.
Es war vor allem die Ambiguität der Figur. Wir sind an Filme gewöhnt mit Figuren, die wir mögen, und anderen, die wir nicht mögen. Und an diesem Entweder-oder ändert sich bis zum Schluss nichts. Travis Bickle mochte ich anfangs, dann ging er mir aber auch wieder gegen den Strich, und manchmal hätte ich ihm am liebsten eine gelangt. So ist das Leben. Ich war zwei Stunden komplett an ihm dran.
Das Kino wäre demnach ein Ort, an dem wir als Einzelne, aber auch als Gesellschaft den Umgang mit Ambiguität lernen und bestärken können. Man spricht ja auch konkret von Ambiguitätstoleranz als einer wesentlichen Tugend.
Es gibt auch Grenzen dieser Toleranz. Das müssen wir als Gesellschaft herausfinden. Wir kultivieren heutzutage ein Höchstmaß an Individualität, und andererseits sollen auch alle irgendwo gleich sein. Das passt nicht zusammen. Wenn jemand aus der Reihe schlägt, sollte diese Person auf jeden Fall nicht die ganze Welt vor sich auf die Knie zwingen können.
„Therapie für Wikinger“ ist ein schönes Beispiel für einen generellen Befund: Es gibt Dramen, aber kaum noch Tragödien, und wenn, dann werden sie als Komödie erzählt. Lösen sich die alten Gattungen auf?
Wenn wir an die griechischen Komödien denken: Da war die Ordnung der Gattungen sehr strikt. Die Komödien nutzten das, um Kritik an den Autoritäten zu transportieren. Aristophanes sprach sehr konkret von unhaltbaren Zuständen, er war also sehr ernsthaft, und dann hüllte er alles in etwas Verrücktes, damit man ihn damit durchkommen ließ. Ohne schwarzen Humor kommen wir nicht durch. Das steckt hinter diesen Vermischungen.
1996 wurden Sie mit dem Film „Pusher“ bekannt, für den Sie sich den Kopf kahl scheren ließen. Eine Anspielung auf die Irokesenfrisur des „Taxi Driver“?
Ich glaube, das war ich selbst, der das vorschlug. Diese beiden Typen, die einzigen Schauspieler im Film, hatten eine Dunkelheit in ihren Augen, die mir fehlte. Ich war ja nie Teil dieses Drogenmilieus in Kopenhagen. Also brauchte es etwas Radikales, damit diese Figur des Tonny sich Respekt verschaffen konnte.
„Pusher“ haben Sie mit Nicolas Winding Refn gemacht, der später mit „Walhalla Rising“ oder „Only God Forgives“ ein Kultregisseur wurde. Es war die Zeit von Dogma 95, als das dänische Kino mit Thomas Vinterberg oder Lars von Trier zu Weltgeltung gelangte.
Wir haben den Film auf eine Weise gemacht, die von Dogma 95 mit einem Manifest festgelegt wurde: Handkamera, kein zusätzliches Licht, alle diese Sachen. Nur haben wir davon nicht gesprochen. Wir hatten einfach nicht das Geld für mehr, außerdem sollte der Film sehr dokumentarisch wirken. Im Kern geht es für mich bei Dogma 95 darum, dass die Geschichte wieder stärker im Mittelpunkt stehen soll.
Sind Sie mit Winding Refn noch in Kontakt?
Er war neulich bei meinem Geburtstag. Wir sind Teile unserer beiden Lebensreisen und ergänzen einander gut: Er redet nur über Filme. Ich rede nur über Sport.
Ihre Begeisterung für Fußball ist bekannt. Wie erinnern Sie den Sommer von 1992?
Haha, ich war in Kopenhagen, und ich war einer von Hunderttausenden, die auf die Straße fluteten, als Dänemark gegen jede Logik Europameister wurde. Man sagt, dass neun Monate später 20 oder 30 Prozent mehr Babys geboren wurden, als statistisch erwartbar gewesen wäre. Ich schaue aber nicht nur Fußball. Tour de France ist genauso spannend.
Was fasziniert Sie an diesen Sportarten?
Es ist das Drama. Jemand gewinnt, alle geben das Beste. Oft passieren Dinge, die man aus jedem Drehbuch streichen würde, weil sie zu verrückt sind.
Wann sind Sie Anders Thomas Jensen zum ersten Mal begegnet?
Ich war gerade mit dem Studium fertig, das war eben Mitte der Neunzigerjahre. Er schrieb Kurzfilme. Wir haben ziemlich gestritten zu Beginn, denn wir waren beide sehr provokant damals.
Seine Filme sind unterhaltsam, im Detail aber sehr vielschichtig. Muss er seine Intelligenz ein wenig verstecken?
Intelligenz ist vielfältig. Ich kenne Schauspieler, die man nicht für superschlau halten würde, die aber eine untrügliche Intuition haben. Thomas ist sehr, sehr schnell im Kopf, und wenn er redet, kommen Sachen, mit denen niemand rechnen würde.
Glauben Sie an so etwas wie Schicksal? Karma? Ihre Karriere wirkt, als wäre alles ganz leicht gegangen.
Ich habe mich nie zurückgelehnt, aber ich habe immer im Moment gelebt und nie an etwas gedacht, was in zwei Jahren kommen sollte. Ich kenne Menschen, die so auf einen bestimmten Traum fixiert sind, dass sie alles nur als Schritte in diese Richtung sehen. Auf diese Weise kann schnell ein Leben vorbei sein.
Was ist ausschlaggebend, wenn Sie ein Drehbuch vor sich haben?
Wenn es schlecht geschrieben ist! Wenn keine Wellenlänge mit dem Regisseur besteht! Manchmal sehe ich einen Film oder ein Feuer aber auch in schlechten Drehbüchern. Oder wenn ich etwas nicht ganz verstehe – dann wird es interessant!
Lesen Sie viel selbst, oder wissen Ihre Leute schon, was sie gleich in die Schublade legen können?
Die meisten Sachen kommen zu mir durch. Darauf bestehe ich. Ich könnte ja etwas bemerken, was nur mir auffällt. Meine Leute sind sehr gut und kennen mich auch sehr gut. Aber ich möchte da nichts riskieren.
Sie haben behauptet, Ihnen wäre nicht klar gewesen, was für ein Riesending die James-Bond-Reihe ist, als Sie die Rolle des Bösewichts Le Chiffre für „Casino Royale“ angenommen haben.
Das lag an mir. Ich habe nie „Star Wars“ geschaut, und ich habe keine Filme mit James Bond geschaut. Ich habe B-Filme geschaut und Horrorfilme. Heute verstehe ich, was an James Bond groß war. Aber meine Helden waren der Karatekämpfer Bruce Lee oder Buster Keaton, Charles Bronson.
Buster Keaton muss für Sie als Schauspieler besonders interessant sein. Er ist ja berühmt für sein regloses Gesicht. Es sieht oft aus, als spiele er gar nicht.
Er macht schon viel, aber natürlich war das frühe Kino anders. Manchmal bemerkt man, wie sich eine kleine Freude in seinen Stoizismus schleicht, und dann öffnet sich der Himmel.
Sie haben immer wieder international Rollen angenommen, demnächst auch in dem sehr spannenden „Dust Bunny“. Gab es irgendwann, zum Beispiel nach „Casino Royale“, einen Moment, in dem Ihr Leben, Ihre Karriere vielleicht außer Kontrolle geraten hätte können?
Ich hatte immer Dänemark. Das hat mir immer gereicht. Es macht Spaß, in Hollywood zu arbeiten oder sonst wo. Aber meine Freunde, meine Sprache, meine Familie, das war immer Dänemark. Wir machen da zwar keine riesigen Piratenfilme, aber wir machen unser Ding.

 vor 4 Stunden
1
vor 4 Stunden
1


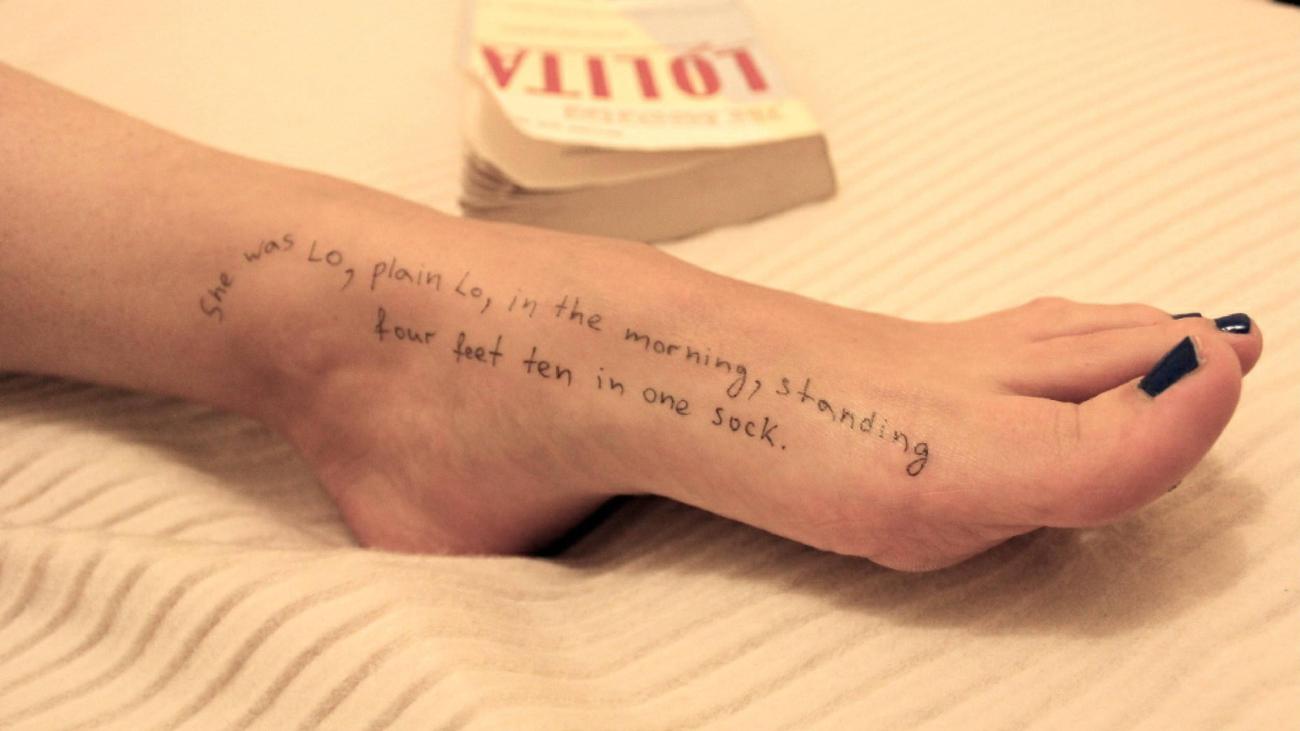







 English (US) ·
English (US) ·