So sehr habe ich mich in der Vorweihnachtszeit nach Leichtigkeit und Freude gesehnt, weg von dem bedrückenden dystopischen Geschehen. Und doch geriet ich unerwartet in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, als hätte sich plötzlich dieser Krieg in mir entzündet. Fast alles, was mir in diesem Monat über den Weg lief oder was ich selbst auswählte, eine Begegnung, ein Buch, ein Film, eine Ausstellung, ein zufälliges Gespräch – entstammte jener Zeit.
Ich fühlte mich wie auf einer Quest, vor einer willkürlichen Abfolge von gedanklichen Bildern. Wodurch wurde diese Wahrnehmung aktiviert? Ist es der politische Wahnsinn von heute, der die Vorstellungskraft für noch Schlimmeres trainiert und Erinnerungen zurückholt? Ein Alarmzustand? Sind die Grenzen zwischen Gut und Böse erneut verschwommen? Die letzten Zeugen verlassen uns bald, und dann – ist wirklich alles erlaubt? Der russische Krieg in der Ukraine dauert bereits länger als der deutsch-sowjetische Krieg – wirklich, so lange schon?
Nach der Jubiläumsfeier der Stiftung „Erinnerung, Verantwortlichkeit, Zukunft“, einer der wichtigsten deutschen Institutionen der Geschichtsaufarbeitung, zu der auch die wenigen verbliebenen Überlebenden eingeladen wurden, fragte mich jemand, ob ich Anastasia Gulej schon kenne. Sie sei eine ukrainische Zwangsarbeiterin, habe drei Lager überlebt, auch das Lager A. und das Lager B. Sie sei 100 Jahre alt, gerade aus Kiew nach Berlin gekommen und leite den ukrainischen Verband für ehemalige KZ-Flüchtlinge. „Hast du ihre Nummer gesehen?“
Die Berührung hat alles erzählt
Es klang wie eine Nachricht von einem fernen Planeten. Ich suchte sofort nach ihr, und kurz darauf saßen wir, Anastasia und ich, in einer tiefen Umarmung in der fast leeren Halle. Wir haben gekuschelt, ich streichelte Anastasias Hände und sie die meinen. Mit ihrem wuscheligen Haar ähnelte sie dem Mutterschaf aus dem Film meiner Kindheit. Sie saß da wie eine Urmutter, wie ein sagenhaftes Wesen – strahlend, robust, lebenslustig. Ich umarmte sie, als könnte ich alles, was mit ihr geschah, umarmen, das ganze (ukrainische) Jahrhundert.
Anastasias Vater war ein Dorflehrer, nur wenige aus der Familie überlebten den Holodomor und die Kollektivierung, als dann der Krieg kam. Wir haben nur wenig gesagt, die Berührung hat alles erzählt, über die Trauer, die wir teilten, Trauer um Krieg und seine Opfer, von damals und von heute. Es war physisch und metaphysisch zugleich: der gegenseitige wortlose Trost.
Dann erzählte sie mir unvermittelt, aber langsam, als würde sie das Folgende abbremsen wollen, von zwei polnischen Frauen im Gefängnis von Tarnów, Helena und Katarzyna, im Jahr 1943, über ihre schönen Kleider und wie anständig sie waren und wie sie im Keller des Gefängnisses erschossen wurden. „Das Gedröhn höre ich“, sagte Anastasia. Ja, sie wurden erschossen, weil sie Juden bei sich versteckt hatten. Sie sprach mit brechender Stimme von Zwiebelfeldern und einer Folterszene aus dieser Zeit, und ich merkte, wie mein Verstand wegdriftete. Gerade hatte ich eine Ukrainerin getroffen, die sechs Jahre in einem russischen Gefängnis eingesperrt war und alle Arten von Folter erlebt hatte. Warum hatte sie mir das erzählt?
Ein Ort in der Mitte Polens
In der gleichen Woche habe ich mich endlich getraut, den legendären Film „Shoah“ von Claude Lanzmann in voller Länge zu schauen, den ich nur teilweise kannte. Nach allem, was institutionell getan wurde, um die Nazi-Verbrechen aufzuklären, erschüttert der Film durch seine unerträglichen Inhalte, aber auch durch seinen extrem privaten Charakter. Ein paar Menschen sind unterwegs, um den Zivilisationsbruch in einem fast archäologischen Verfahren aufzudecken. Im Film kommen viele leere Bahnhöfe vor, mit weltbekannten schrecklichen Namen. Ganz am Anfang zieht Lanzmann mit den letzten Überlebenden von Kulmhof (Chelmno) durch die Landschaft: Hier fing im Dezember 1940 weit vor der Endlösung die Massenvernichtung an, direkt in den Gaswagen. Lanzmann und die Überlebenden führen ein surreales Gespräch stellvertretend für die 100.000 Toten. Dann erscheint ein kaum bekannter kleiner Bahnhof, es ist Kolo, ein Ort in der Mitte Polens. Mein Urgroßvater stammte von dort. Später gründete er in Kalisz, in Warschau und in Kiew Taubstummenschulen für Waisenkinder.
Google Maps zeigt mir: zehn Minuten Autofahrt nach Kulmhof. Nie zuvor hatte ich an die fernen Verwandten gedacht, die niemand zu retten versuchte, die zu den ersten Opfern zählten. Aber eigentlich braucht man keine Verwandten, um all das immer wieder nicht zu verstehen.
Das Wort „genug“ steckte mir im Hals
Wegen Kulmhof habe ich mich an Thomas Harlan erinnert, den Sohn von Veit Harlan, dem berüchtigten Regisseur des Films „Jud Süss“, den alle Aufseher von Auschwitz schauen mussten. Thomas Harlan war ein rebellischer Aufklärer der Täterschaft, ein Einzelkämpfer. Immer noch kaum rezipiert, stellt er einen Gegenpol zum deutschen Erinnerungs-Mainstream dar. 1953 reiste er als junger Mann mit Klaus Kinski nach Israel, schrieb ein Theaterstück über das Warschauer Ghetto und klagte Hunderte Richter, Juristen und Beamten an, die weiter lebten, als sei nichts geschehen. Unversöhnlich recherchierte er über ein Jahrzehnt in Polen in Vorbereitung seines Buches „Viertes Reich“.
Kulmhof war für ihn ein persönlicher Schmerz, er schrieb das Buch „Rosa“, in dem alles zerfällt angesichts des hier stattgefundenen Mordens – die Sprache, die Menschen, die Natur. Thomas Harlan war der Meinung, dass die Deutschen nicht einmal angefangen haben zu verstehen, was damals geschah. Ihm und seiner Täterliteratur widmet sich das gerade erschienene Buch „Aus Fassungslosigkeit“, in dem auch seine Liste vorkommt: auf der einen Seite Hunderttausende Opfer, auf der gegenüberliegenden die dafür bestraften einzelnen (oder fehlenden) Täter. Mit diesem Buch in der Tasche trat ich an einen Tisch bei einer Weihnachtsfeier.
Eine Frau erzählte gerade von ihrer Arbeit in der Nachbarschaft, in einem der erstaunlichen Berliner Vereine, die die Menschen vernetzen und ihr Leben verbessern. Als sie von den historischen Anfängen sprach, sagte sie plötzlich in einem Nebensatz: „Deutsche haben genug Widerstand geleistet.“ Ich konnte nicht glauben, was ich hörte. Das Wort „genug“ steckte mir im Hals. Nach allem, was wir über den rätselhaft unzulänglichen Widerstand wissen, hatte ich einen solchen Satz von so einer Frau nicht erwartet. Ich sagte, das stimme einfach nicht, und sie entgegnete, dass es leicht sei, darüber bei einer Feier zu diskutieren. Mich überkam eine enorme Trauer. Mit meiner Bemerkung hatte ich das Fest verdorben. Damit, dass mich niemand unterstützte, war auch vieles gesagt. Wie kann es sein, dass man heute so sprechen darf, als wäre nicht einmal diese Tatsache Konsens?
Vor Kurzem habe ich Anastasia Gulej in Kiew angerufen, wo die Blackouts bis zu 16 Stunden pro Tag dauern. Ihre beiden Frauen gingen mir auch nicht aus dem Kopf. Anastasia hatte Geburtstag, sie ist wirklich 100 geworden, und es gab sogar Strom!
Ich denke an Bomben über Kiew, an Helena und Katarzyna, an das Wort „genug“ und auch an die Erfolge der Erinnerungskultur, die nicht verhindern konnte, dass die hundertjährige Anastasia und alle anderen dort wieder im Krieg leben, vielleicht auch, weil uns scheint, wir hätten genug getan.

 vor 1 Tag
4
vor 1 Tag
4


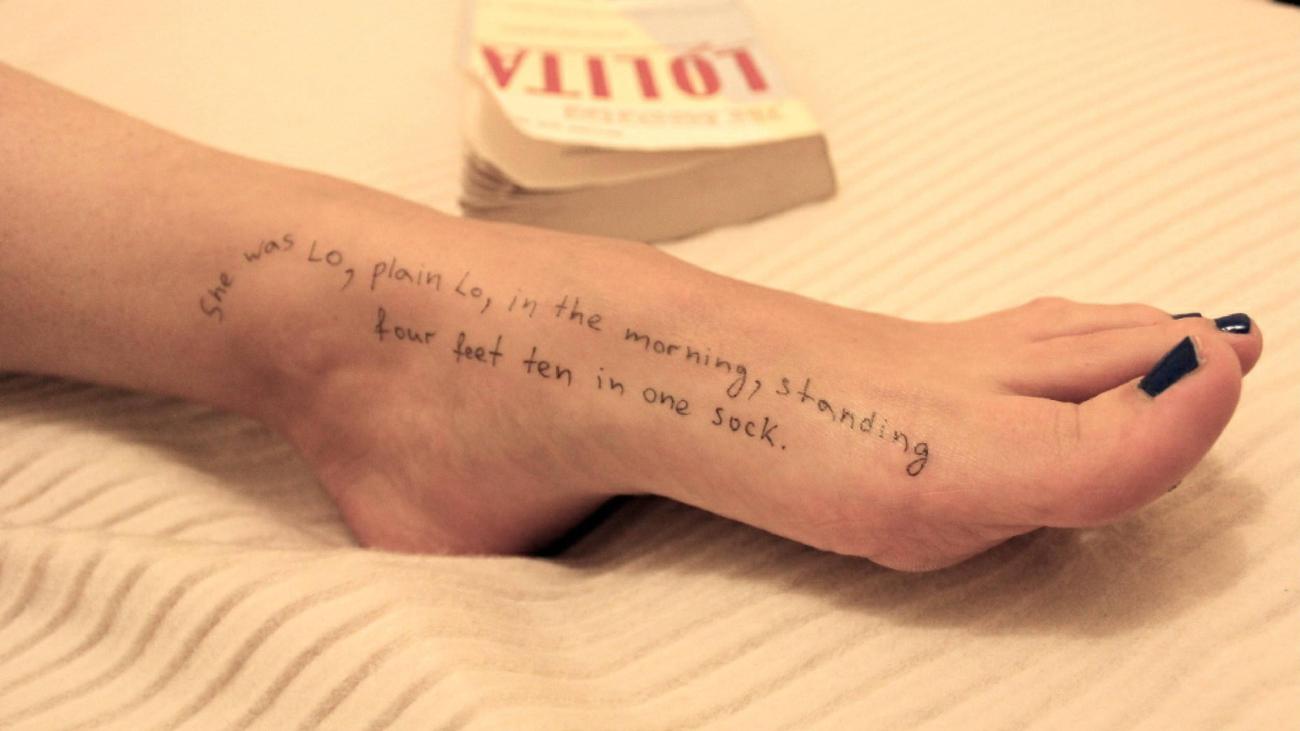







 English (US) ·
English (US) ·