Vor 70 Jahren wurde die im Krieg zerstörte Wiener Staatsoper mit Ludwig van Beethovens „Fidelio“ neu eröffnet. Am Jahrestag, dem 5. November 2025, gedachte das Haus mit einem Festakt dieses Ereignisses, nicht ohne einmal mehr darauf hinzuweisen, dass der erste Direktor der neuen Staatsoper, der Dirigent Karl Böhm, auch der letzte der NS-Zeit war. An der Außenfassade wurde zudem eine Gedenktafel enthüllt, die an jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erinnert, die dem Naziterror zum Opfer gefallen waren – zweifellos eine wichtige Geste, die aber der Verantwortung nicht gerecht wird, welche die Wiener Staatsoper jenen Komponisten gegenüber hat, deren Musik vom NS-Regime als „entartet“ gebrandmarkt wurde. Das Schaffen Zemlinskys etwa wird im Haus am Ring nach wie vor sträflich vernachlässigt, Schrekers Werke sucht man ebenfalls vergeblich, und Schönberg, dessen 150. Geburtstag die aktuelle Intendanz im Vorjahr völlig ignorierte, war zuletzt dem 2010 aus dem Amt geschiedenen Langzeitdirektor Ioan Holender ein Anliegen.
Auf das 70-Jahr-Jubiläum geht die Wiener Staatsoper einzig mit einer Neuproduktion des „Fidelio“ ein, die eine Regie von Otto Schenk in den Bühnenbildern Günther Schneider-Siemssens ablöst. Diese brachte es in 54 Jahren auf 253 Aufführungen und wurde für Wiens Opernfreunde fast schon zum verlängerten Wohnzimmer. Mit der Last einer solch starken Tradition auf den Schultern wagte sich nun der Staatsopern-Debütant Nikolaus Habjan an eine Neuinterpretation heran. Als renommierter Puppenspieler brachte er zwei lebensgroße Puppen mit: Eine verdoppelt Leonore, die sich als junger Mann ausgibt und unter dem Namen Fidelio das Vertrauen des Kerkermeisters Rocco, ungewollt aber auch das Herz seiner Tochter Marzelline gewinnt. Leonore ist auf der Suche nach ihrem Gatten Florestan, der den Verbrechen Don Pizarros auf die Spur gekommen war und dafür nun in dessen Kerker schmachtet.
Mitunter sogar ironisch
Als Fidelio muss sie sich verstellen, ein Part, den mit stupender Souveränität die Puppe übernimmt. Was in Leonore als Frau tatsächlich vorgeht, bringt hingegen Sopranistin Malin Byström zum Ausdruck, mit dunkel getöntem, farbenreichem Timbre, fast alle Klippen der heiklen Arie bravourös umschiffend, ohne freilich große Vorgängerinnen in dieser Partie vergessen zu machen. Als weniger sinnvoll erweist sich die Verdopplung bei Florestan, den David Butt Philip zunächst mit etwas unstet geführtem Tenor beginnt, der sich später aber als solider und höhensicherer Darsteller erweist. Hätte Habjan die Puppen im Finale weggelassen, wo sie keine erkennbare Funktion mehr haben, wäre seine Idee um einiges überzeugender ausgefallen.

Für Erleichterung unter Wiens Opernfreunden sorgte, dass sich die neue Regie gar nicht so sehr von der Vorgängerproduktion unterscheidet. Die Bühne von Julius Theodor Semmelmann sowie die Kostüme Denise Heschls haben zwar einen modernen Touch, aber im Grunde bleibt vieles beim Alten. Etwas mehr Mut und Sinn für suggestive Bilder, wie es die sich öffnende Zugbrücke als Symbol der Freiheit in der Vorgängerproduktion war, würden der Produktion guttun.
Immerhin drehte Habjan an einigen Schrauben, um daran zu erinnern, dass Diktaturen nur funktionieren, wenn es willige Helfer und Mitläufer gibt. Dabei wird er von Paulus Hochgatterers gelungener neuer Textgestaltung unterstützt, die sich mitunter sogar ironisch gibt: Bei ihm will Rocco Fidelio zum „Schwiegersohn“ machen, worauf Jaquino, das Original zitierend, prompt feststellt, sonst habe er doch immer „Tochtermann“ gesagt.
In alter Manier an der Rampe
Jaquino – von Daniel Jenz temperamentvoll gesungen – erweist sich als einer dieser Mitläufer. Er ist es, der Pizarro vor der Untersuchung des von ihm geleiteten Gefängnisses warnt, sich im Finale aber als typischer Wendehals in Position bringt, nun der Gegenseite zu dienen. Rocco, der zur berühmten „Goldarie“ allerlei Schmuckstücke aus diversen Verstecken seines eintönig braunen Wohnzimmers holt, macht kein Hehl daraus, dass er sie den Gefangenen abgenommen hat, weil diese sie ohnehin nicht mehr brauchen würden. Dennoch ist es Rocco, von Tareq Nazmi stimmlich etwas zu eindimensional angelegt, der sich einen Rest von Anstand bewahrt und sich in der entscheidenden Befreiungsszene auf die Seite Leonores stellt, ihr sogar die Pistole abnimmt und Pizarro zum Aufgeben seiner mörderischen Absicht zwingt.
Christopher Maltman bringt die Brutalität und Verschlagenheit des Gouverneurs eindrucksvoll zu Gehör, begünstigt dadurch, dass er seine Arie in alter Manier an der Rampe singen darf, wovon auch Kathrin Zukowski als Marzelline mit ihrem hübschen, perfekt geführten Sopran profitiert.
Ein Kunststück
Neben dem prächtig singenden, darstellerisch eher zu Statuarik verurteilten Chor war es trotz minimaler Irritationen vor allem das Orchester unter Franz Welser-Möst, das den Abend zum Ereignis werden ließ. Schon im Duett zwischen Marzelline und Jaquino zu Beginn werden Töne angeschlagen, die in ihrer Gewaltbereitschaft jeder Illusion einer heilen Welt eine Absage erteilen. Als echter Musikdramatiker erweist sich Welser-Möst nicht zuletzt dadurch, dass er mit der Musik dynamisch und agogisch stets auf den Text reagiert und diesen ausdeutet. Auch die 3. Leonoren-Ouvertüre, seit der Einfügung Gustav Mahlers zwischen Kerkerbild und Finale in Wien unumstößliche Tradition, degradiert Welser-Möst nicht zum orchestralen Bravourstück, sondern nutzt sie dramaturgisch als Überleitung zum emphatischen Finale. In diesem entfacht er einen wahren Furor, der die Mitwirkenden an die Grenze des Machbaren führt.
Beethovens Zeitgenossen hatten bei der Ausführung seiner Musik mitunter technische Schwierigkeiten. Heute stellt sie diesbezüglich kaum noch ein Problem dar, aber ihre volle Wirkung entfaltet sie nur dann, wenn von dieser Herausforderung in modernen Interpretationen noch etwas zu spüren ist. Franz Welser-Möst ist dieses Kunststück gelungen. Dafür wurde er zu Recht bejubelt.

 vor 2 Tage
3
vor 2 Tage
3


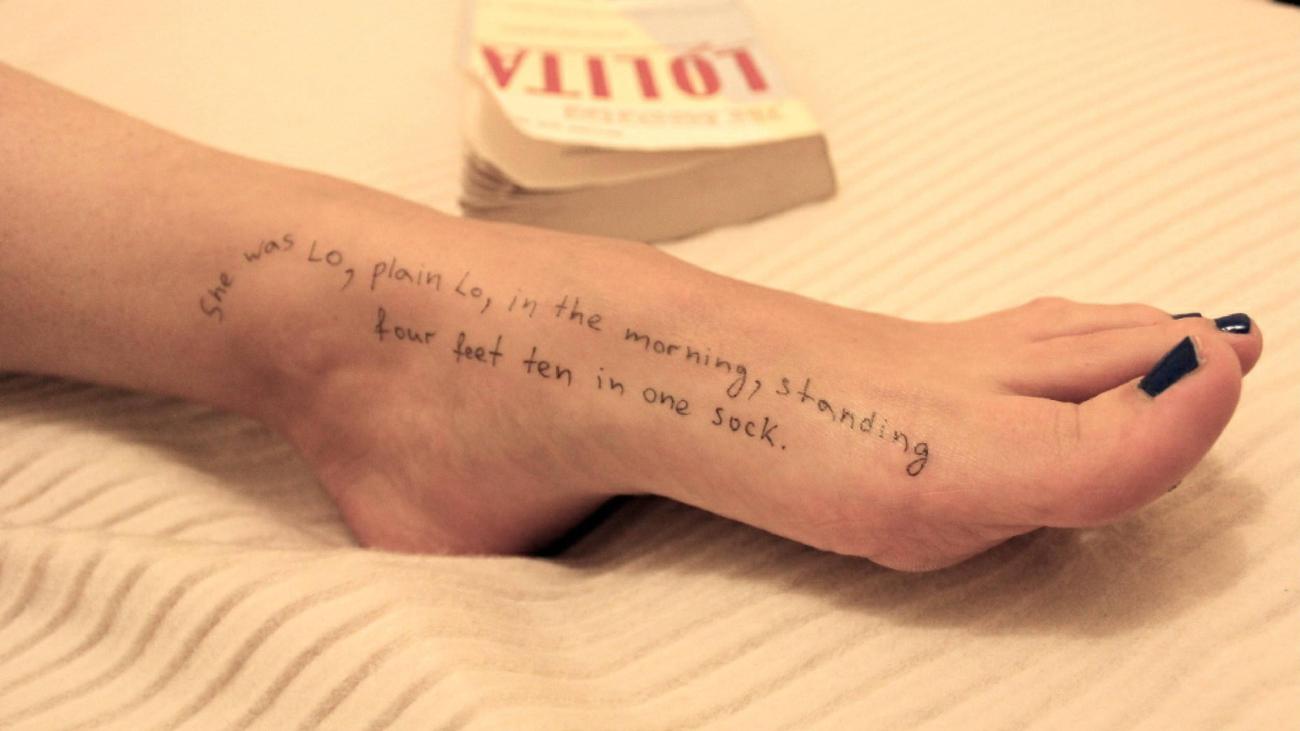







 English (US) ·
English (US) ·