Die Indisponiertheit des Herzens
Anton Tschechows „Möwe“ am Londoner Barbican Theatre mit Cate Blanchett
 Die Altersangst im Nacken: Cate Blanchett als ArkadinaMarc Brenner
Die Altersangst im Nacken: Cate Blanchett als ArkadinaMarc BrennerDieser Londoner Abend ragt aus den üblichen Theatergepflogenheiten heraus, nicht nur, weil er eine der besten Schauspielerinnen der Welt grandios in Szene setzt. Sondern auch, weil er vom oft beschwiegenen Sinneskonflikt zweier Generationen erzählt, die sich fremd sind. Er erzählt von einer Jugend, die den Schmerz früher kennenlernt als die Liebe, und einem Alter, das sich mit falscher Ironie gegen das richtige Lebensgefühl wehrt: die Traurigkeit würde beide verbinden.
Bleiben ist besser als warten
Samuel Becketts „Warten auf Godot“ am Berliner Ensemble mit Matthias Brandt
 Um die Traurigkeit zu fassen, braucht es Klamauk: Paul Herwig als Wladimir hält Matthias Brandt als Estragon im Arm.Jörg Brüggemann
Um die Traurigkeit zu fassen, braucht es Klamauk: Paul Herwig als Wladimir hält Matthias Brandt als Estragon im Arm.Jörg BrüggemannZwei Tage vor Becketts einhundertneunzehntem Geburtstag schenkt Luk Perceval dem Berliner Publikum einen überzeugend zeitentrückten Abend. Wo sich gerade alle im Kopfschütteln über die Weltlage überbieten, bleiben hier zweieinhalb Stunden lang die Köpfe ganz still. „Wir werden alle verrückt geboren, und einige bleiben es“, seufzt Brandts Estragon an einer Stelle. Und so zeigt diese Inszenierung vielleicht vor allem, dass es in dem Stück und im Leben nicht nur ums Warten, sondern auch ums Bleiben geht. Ums Stillebewahren. Darum, die Zeit miteinander zu verbringen, im Leben, im Träumen, in Gedanken. Ums Beieinanderbleiben trotz aller Umstände. Das ist am Ende das einzig mögliche Glück, von dem Beckett uns berichtet. Es spiegelt sich in einem frühen Dialog dieses Stücks, da sagt Estragon „kühl“: „Manchmal frag ich mich, ob es nicht besser wäre, auseinanderzugehen.“ Und Wladimir antwortet mit herzenskluger Wärme: „Du würdest nicht weit kommen.“
Achtung vor dem Ich des anderen
Ernst Tollers „Hinkemann“ am Deutschen Theater in Berlin
 Am Ende vereint: Lorena Handschin und Moritz Kienemann in der Berliner Inszenierung von „Hinkemann“Konrad Fersterer
Am Ende vereint: Lorena Handschin und Moritz Kienemann in der Berliner Inszenierung von „Hinkemann“Konrad FerstererEin grandioser Theaterabend, ein Abend, der das Humane über das Ideologische zu stellen wagt. Im Tieferen plädiert diese Aufführung von Anne Lenk für mehr Achtung vor dem Ich des anderen. Selbst der fremde Freund, der trotz aller lustverliebten Versprechen am Ende eben doch gehen muss, hat ein Recht darauf. Wenn er von draußen noch einmal in das hell erleuchtete Fenster schaut und das wiedervereinigte Paar sieht, wie es sich umarmt und küsst, die Zukunft auf seiner Seite, das richtige Leben bei sich, dann will man ihn unwillkürlich schützen. Will ihm die Augen zuhalten, das Herz abschirmen und ins Ohr flüstern: „Schau nicht hin!“ Die Schwäche, so wie sie sich an diesem grandiosen Theaterabend zeigt, ist keine des Mannes, es ist eine des Menschen. Sie hat mit seinem Glauben und seiner Liebeshoffnung zu tun. Und damit, wie einsam er sich fühlt, wenn andere zu zweit sind.
Beeilt euch, zu leben!
Vladimir Sorokins „Schneesturm“ bei den Salzburger Festspielen mit August Diehl
 Furioser Auftritt eines für die Bühne gemachten Spielers: August Diehl als Dr. Garin in Serebrennikovs „Schneesturm“Ruth Walz
Furioser Auftritt eines für die Bühne gemachten Spielers: August Diehl als Dr. Garin in Serebrennikovs „Schneesturm“Ruth WalzEin furioser, ein mitreißender Schauspielerabend: August Diehl und Filipp Avdeev bilden ein kongeniales Schlittenpaar, das sich gerade wegen seiner sprachlichen Differenzen blind versteht. In einem raren Moment metaphysischen Innehaltens rezitiert der Kutscher in seinem gebrochenen Deutsch einen alten Fuhrleutespruch: „Fährst du allein, sitzen auf deinen Schultern zwei Engel, fährt man zu zweit, nur ein Engel, zu dritt: ist der Satan im Wagen.“ Es hat seinen Grund, dass in der amerikanischen Präsidentenlimousine in Alaska vor Kurzem drei Männer saßen.
Komm in den totgesagten Abgrund
 Die, die im Dunkeln stehen: Jens Harzer als Oscar WildeMarcus Lieberenz
Die, die im Dunkeln stehen: Jens Harzer als Oscar WildeMarcus LieberenzDas größte Schauspielereignis des Jahres ist am Berliner Ensemble mit Jens Harzer zu sehen. Von Ferne ein wenig auf Becketts Krapp verweisend, lässt Harzer die Plastiktüte sinken, rutscht nach vorne, setzt sich an den Rand des Abgrunds: „Ich habe einmal das Denken der Menschen verändert“, sagt er und nimmt Abschied von der Gesellschaft. Nur die Natur hat jetzt noch Platz für ihn, irgendeine Felsspalte oder das Meer. Und dann tritt der Künstler vor sein Publikum, tritt dieser Jens Harzer aus seiner Zelle in die Freiheit einer neuen Bühne und flüstert mit jener anziehenden Zartheit, die jede Entschuldigung nach Einladung klingen lässt: „Vielleicht müssen wir einander erst noch kennenlernen.“
In ihrer Beklemmung frei
Ödön von Horváths „Kasimir und Karoline“ am Residenztheater München
 Der umgestürzte Krug: Anna Drexler und Simon Zagermann als Karoline und Kasimir auf der WiesnMatthias Horn
Der umgestürzte Krug: Anna Drexler und Simon Zagermann als Karoline und Kasimir auf der WiesnMatthias HornEs liegt eine unheilvolle Lakonie über dieser Inszenierung. Das Unterkühlt-Düstere ist man von der Regisseurin Barbara Frey ja gewohnt, kein „Onkel Wanja“, kein „Hamlet“, der von ihr nicht in eine eisige Aurafolie gehüllt würde, unprätentiös, emotionsskeptisch, ein paar humorige Einlagen hier und da, die Bühne meist nackt, die Kostüme historisierend. So auch hier: Martin Zehetgruber hat die düstere Spielfläche mit verwehten Herbstblättern und verlassenen Caféstühlen ausgestattet und ein paar überdimensionierte Maßkrüge aus dem Hofbräuhaus in die Mitte gestellt. Ein Stillleben, das vor allem still ist und nach wenig Leben aussieht. Die Figuren wirken wie Gespenster auf der Suche nach einer Anstellung, sie setzen sich, starren aneinander vorbei, schütten sich Bier ins Gesicht.
Ein Bild, das nie verschwindet
Ágota Kristófs „Das große Heft“ am Hamburger Schauspielhaus
 Das Menetekel sind die Bilder im Kopf: Nils Kahnwald und Kristof Van Boven als ZwillingsbrüderLalo Jodlbauer
Das Menetekel sind die Bilder im Kopf: Nils Kahnwald und Kristof Van Boven als ZwillingsbrüderLalo JodlbauerEine Szene mit Überlebenden des Hamburger Feuersturms ist die eindrucksvollste des Theaterjahres 2025. Die Inszenierung von Karin Henkel, die sich, basierend auf Ágota Kristófs Prosatext „Das große Heft“, an den Krieg als Inbegriff des inneren Erlebens heranwagt, ist außergewöhnlich. Der Roman aus dem Jahr 1986 erzählt von zwei namenlosen, etwa zehnjährigen Zwillingsbrüdern (hier kongenial gespielt von Kristof Van Boven und Nils Kahnwald) in einem nicht näher benannten, kriegsgezeichneten Land, die zu ihrer Großmutter aufs Land geschickt und dort gequält werden. Großes Erinnerungstheater. Herzergreifende Umsetzung.
Das böse Monster spielt schön auf
„Richard III.“ von William Shakespeare am Wiener Burgtheater
 Nicholas Ofczarek als Richard III.Tommy Hetzel
Nicholas Ofczarek als Richard III.Tommy HetzelEin gefühlskluger Theaterabend. Regisseur Wolfgang Menardi trägt keinen Traktat über Macht vor, und bis auf zwei kurze, scherzhafte Gesten von Starschauspieler Nicholas Ofczarek unterbleibt auch jede Anspielung auf Tyrannen unserer Tage. Das Stück hält keinen Rat bereit, und auch die Hoffnung auf einen besseren Thronfolger, Shakespeares Lippendienst für die Tudors, ist hier gestrichen. Shakespeares Bühne, das zeigt der fabelhafte Abend, war keine moralische Anstalt.
Lustvolle Suche nach den Wurzeln des Krieges
Lew Tolstois „Krieg und Frieden“ in Magdeburg inszeniert von Charly Hübner
 Bettina Schneider und Nils Hummel in „Krieg und Frieden“ in MagdeburgKerstin Schomburg
Bettina Schneider und Nils Hummel in „Krieg und Frieden“ in MagdeburgKerstin SchomburgMan muss in dieser schwungvoll-verspielten Inszenierung von Charly Hübner nicht jede Volte von Tolstois Roman kennen, man kriegt trotzdem genug mit. Ronald Schimmelpfennigs Fassung erzählt das Geschehen empathisch gestrafft, Hübner inszeniert sie mit Geduld, Ernst und Gespür. Er ist ebenso an den Ereignissen des Friedens interessiert, die mit ihren Kabalen und Amouren bestes Schauspielerfutter bieten, wie an den blutigen Verlaufsformen des Krieges. So inspiriert wie zupackend gestaltet das Ensemble diese intensive Auseinandersetzung.
Wenn die Welt zerbröselt
„Antigone“ von Sophokles in moderner Form am Schauspiel Frankfurt
 Ismene (Viktoria Miknevich, links) im Gespräch mit ihrer Schwester Antigone (Annie Nowak)Birgit Hupfeld
Ismene (Viktoria Miknevich, links) im Gespräch mit ihrer Schwester Antigone (Annie Nowak)Birgit HupfeldDie Inszenierung hat Züge eines Kammerspiels auf großer Bühne, sie zittert oft vor Anspannung. Vor allem aber lässt sie ein Ensemble in einem Zusammenspiel glänzen, wie man es lange nicht gesehen hat. Annie Nowak setzt Akzente dort besonders eindrucksvoll, wo die Entschlossenheit Antigones auf das Unverständnis der Umgebung prallt. Dass sie es war, die sich über Kreons Gebot hinwegsetzte, sagt sie in Richtung des Publikums, mit dem Rücken zu ihrem Ankläger, und ihr Lächeln in diesem Moment ist ein Triumph über Kreon und das devote, eifrig nickende Volk. Sie setzt ihrem Handeln einen größeren Rahmen, schließlich werde sie, wie sie sagt, noch sehr viel länger mit denen „da unten“ zu tun haben als mit den Lebenden.

 vor 12 Stunden
2
vor 12 Stunden
2


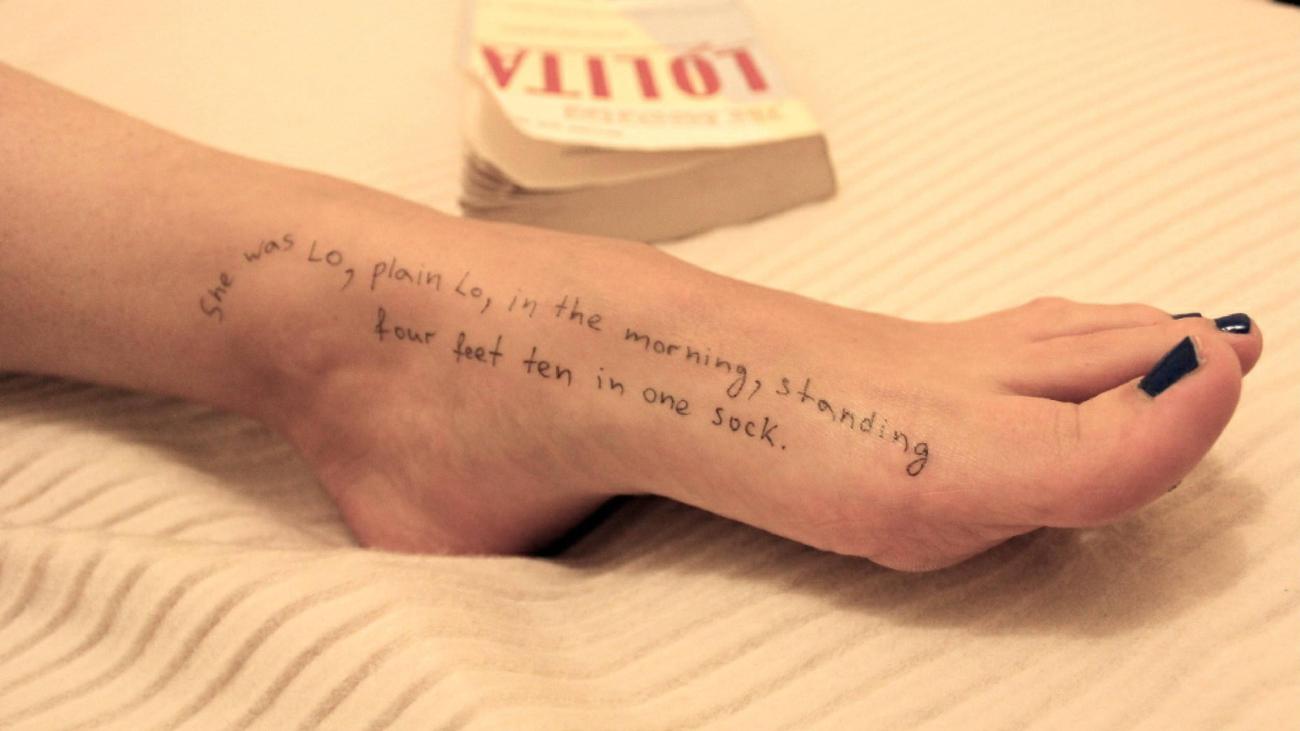







 English (US) ·
English (US) ·